Programm 2023
(Stand 24.10.2023 - Änderungen vorbehalten)
Mittwoch, 25.10.2023
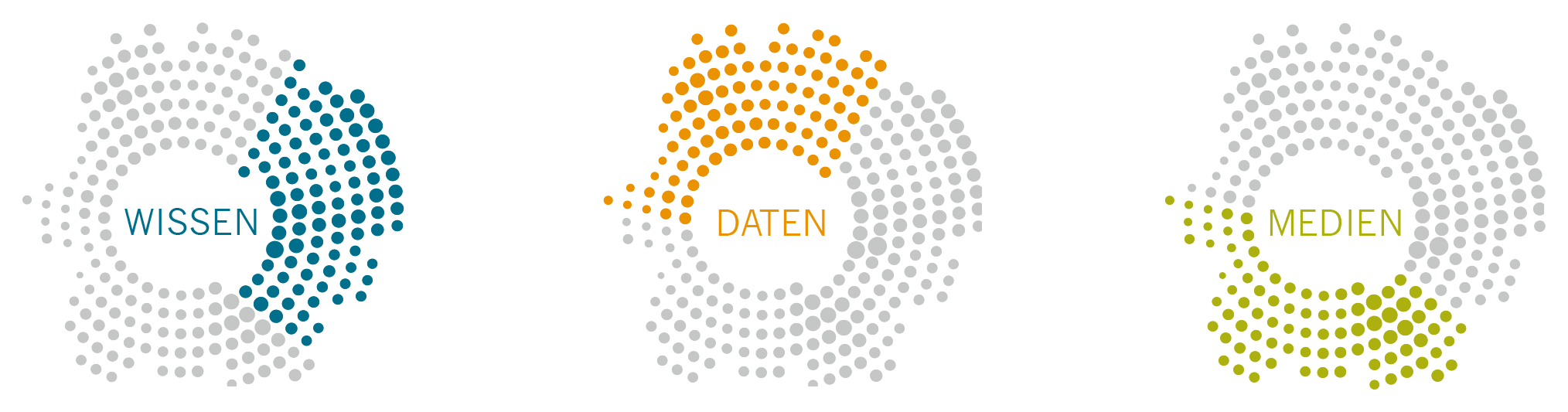
9.00 – 11.30 SMC‐WORKSHOP
Biodiversitätskrise in den Medien
Science Media Center Germany
Saal OPEN FORUM
Mittwoch, 25.Oktober 9.00 – 11.30 Saal OPEN FORUM
SMC‐WORKSHOP
Biodiversitätskrise in den Medien City
Science Media Center Germany
Dabei wollen wir diskutieren: Welche Schwierigkeiten erleben die Teilnehmenden bei der Berichterstattung über Biodiversität? Und wie lassen diese sich überwinden? Wie können Medienberichte einen Bezug zwischen der Biodiversitätskrise und der persönlichen Lebenswirklichkeit herstellen? Sollte die Berichterstattung auf einzelne Renaturierungsprojekte, Schirmarten oder den ökonomischen Wert der Natur fokussieren – und welche Gefahren liegen darin? Welche positiven Beispiele gibt es für Geschichten über Biodiversität, die gut funktioniert haben?
Wenn Sie an dem Workshop teilnehmen möchten, schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Anmeldung Workshop Biodiversität – Wissenswerte“. Am besten nutzen Sie dafür diesen Link. Wir würden uns freuen, wenn Sie ein paar Zeilen über sich schreiben: Für welche Medien arbeiten Sie? Warum möchten Sie an dem Workshop teilnehmen und welche Themen würden Sie gern behandeln? Das SMC teilt Ihnen dann in Kürze mit, ob Sie an dem Workshop teilnehmen können, da die Plätze begrenzt sind.
- Katrin Böhning-Gaese, Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum, Frankfurt am Main Thema: Schutzgebiete und Wildnis in Deutschland – Wie geht es voran mit dem 30x30-Ziel?
- Christoph Scherber, Zentrum für Biodiversitätsmonitoring Bonn Thema: Mit Mischkulturen die Biodiversität in der Landwirtschaft steigern
- Peter Biedermann, Universität Freiburg Thema: Borkenkäfer und naturnaher Wald in Deutschland
11.15 – 11.45 Begrüßung
für neue WISSENSWERTE-Teilnehmer & Netzwerktreffen
Saal MEDIEN
12.00 – 12.30 Begrüßung & Eröffnung
12.30 – 13.30 A1_EINSPRUCH
Wie prekär das Wissenschaftssystem wirklich ist und wie der Wissenschaftsjournalismus darüber berichten sollte
Prof. Amrei Bahr (#IchbinHanna)
Saal WISSEN
Mittwoch, 25.Oktober 12.30 – 13.30 Saal WISSEN
A1_EINSPRUCH
Wie prekär das Wissenschaftssystem wirklich ist und wie der Wissenschaftsjournalismus darüber berichten

Jun.-Prof. Dr. Prof. Amrei Bahr (#IchbinHanna)
Juniorprofessorin für Philosophie der Technik & Information, Universität Stuttgart
Befristungen, Unsicherheit, berufliche Sackgassen: Unter dem Hashtag #IchbinHanna begehren Wissenschaftler:innen gegen ihre Arbeitsbedingungen auf. Im Kern der Auseinandersetzung steht die lang erwartete Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG): Nach der massiven Kritik hat das Forschungsministerium einen überarbeiteten Gesetzentwurf vorgestellt, der erneut Proteste von Wissenschaftsvertretern, Gewerkschaften und Verbänden hervorrief.
Zur Eröffnung der #WW23 schildert die #IchbinHanna-Mitgründerin Amrei Bahr ihren Blick auf die aktuelle Debatte und den Stand bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wie hat die Philosophin und Juniorprofessorin für Philosophie der Technik & Information an der Universität Stuttgart #IchbinHanna in den Medien wahrgenommen? Und was muss sich an der Berichterstattung über das Wissenschaftssystem dringend ändern?
13.30 – 14.30 Pause & Imbiss
14.30 – 16.00
A2_Diskussion
Biodiversitätskrise: Warum geht sie in den Medien meist unter?
In Kooperation mit dem SMC
Prof. Katrin Böhning-Gaese (SBiK-F),
Joachim Budde (RiffReporter),
Dagny Lüdemann (ZEIT Online),
Prof. Christoph Scherber (LIB),
Iris Proff [Moderation]
Saal WISSEN
Mittwoch, 25. Oktober 14.30 – 16.00 Saal WISSEN
A2_Diskussion
Biodiversitätskrise: Warum geht sie in den Medien meist unter?

Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese (SBiK-F)
Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum

Joachim Budde (RiffReporter)
Freier Wissenschaftsreporter / RiffReporter

Dagny Lüdemann (ZEIT Online)
Chefreporterin Wissen, ZEIT ONLINE

Prof. Dr. Christoph Scherber (LIB)
Leiter Zentrum für Biodiversitätsmonitoring, Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB)

Iris Proff (SMC)[Mod.]
Redakteurin für Klima und Umwelt, Science Media Center (SMC)
Der dramatische Verlust von Arten, Populationen und genetischer Vielfalt stellt ein ähnlich existenzielles Risiko für den Menschen dar wie der Klimawandel. Während in den Medien das Klima inzwischen zu einem ressortübergreifenden Querschnittsthema geworden ist, wird die Biodiversitätskrise noch immer fast ausschließlich in Wissensressorts behandelt.
Woran liegt das? Wie werden Biodiversitätsthemen auch für Politik- und Wirtschaftsressorts interessant? Welche Lehren können wir aus der Weltnaturkonferenz COP15 im Dezember 2022 ziehen, während der die Biodiversitätskrise in den deutschen Medien so präsent war wie nie zuvor? Gibt es Beispiele gelungener Berichterstattung aus anderen Ländern? Welche Narrative wecken das Interesse von Leser:innen und Hörer:innen?
A3_Deep Dive KI
ChatGPT & Co: Was können diese KI?
Prof. Hannah Bast (Freiburg),
Sara Boukal (Penmue),
Prof. Frank Hutter (Freiburg),
Prof. Dr. Ulrike von Luxburg (Tübingen),
Sibylle Anderl [Moderation]
Saal DATEN
Mittwoch, 25. Oktober, 14.30 – 16.00 Saal DATEN
A3_Deep Dive [KI]
ChatGPT & Co: Was können diese KI – was müssen wir beachten?

Prof. Dr. Hannah Bast
Professur für Algorithmen und Datenstrukturen, Universität Freiburg

Sara Boukal
Co-Founder, PENEMUE

Prof. Dr. Frank Hutter
Professor für Maschinelles Lernen, Universität Freiburg

Prof. Dr. Ulrike von Luxburg
Professorin für Theorie des Maschinellen Lernens, Universität Tübingen

Dr. Sibylle Anderl [Mod.]
Ressortleiterin Natur & Wissenschaft, FAZ
Sie ist schnell, sie ist klug, und sie verschiebt die Grenzen des bisher Möglichen in der digitalisierten Welt: Als das KI-Unternehmen OpenAI den Chatbot ChatGPT für die Öffentlichkeit zugänglich machte, wurde schnell klar, welche Bedeutung diese Technologie haben könnte. Aufgrund der Leistungsfähigkeit und der leichten Zugänglichkeit setzte schnell ein Hype um den Chatbot ein.
Wir wollen herausarbeiten, welche Stärken und Schwächen KI-Sprachmodelle haben: Wie verlässlich ist das, was Sprachmodelle wie ChatGPT „sagen“? Kann man solchen Programmen vertrauen? Wie sieht es mit dem Missbrauchspotenzial aus? Was können KI-Sprachmodelle gut, worin sind sie schlecht? Und sind sie nun „intelligent“ oder nicht? Wie werden Sprachmodelle auch in Zukunft besser, kann man weiter mit mehr Trainingsdaten skalieren oder sind andere Ansätze notwendig? Und wie können Probleme wie „Halluzinationen“ der KI, toxische oder diskriminierende Sprache behoben werden?
A4_Fishbowl KI
Wie der Journalismus mit der Black Box KI umgehen sollte
Marcus Anhäuser (RiffReporter),
Tilmann Gocht (Exzellenzcluster Maschinelles Lernen),
Elena Riedlinger (Ready to Code),
Jan Lause (Hertie AI),
Prof. Annette Leßmöllmann (KIT) und Prof. Olaf Kramer (Tübingen) [Moderation]
Saal MEDIEN
Montag 14.30 – 16.00 Saal MEDIEN
A4_Fishbowl
Wie der Journalismus mit der Black Box KI umgehen sollte

Marcus Anhäuser
Redakteur Medien-Doktor & RiffReporter

Dr. Tilmann Gocht
Exzellenzcluster Maschinelles Lernen, Universität Tübingen

Elena Riedlinger
Datenjournalistin & Redakteurin für digitale Produktenwicklung, WDR

Jan Lause
Hertie Institute for Artificial Intelligence in Brain Health (Hertie AI)

Prof. Dr. Annette Leßmöllmann [Mod.]
Sprecherin Department für Wissenschaftskommunikation, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Prof. Dr. Olaf Kramer [Mod.]
Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation, Universiträt Tübingen & Sprecher RHET AI
KI stellt den Journalismus vor große Herausforderungen: Die automatisierte Textproduktion macht ihm Konkurrenz, und das Thema ist komplex und schwer zugänglich: Die Algorithmen und Strategien hinter KI-Technologien sind oft gut gehütete industrielle Geheimnisse. Methoden, Hintergründe und Wirkungsweisen bleiben häufig undurchschaubar – KI als Black Box. In der Berichterstattung dominieren anthropomorphe Imaginationen: Wir orientieren uns meist am menschlichen Denken und Handeln, wenn wir über KI schreiben – wie Roboter die Welt übernehmen, wer vom autonomen Auto getötet wird, wann uns KI vor Krankheiten bewahren. Als Konsequenz bleiben die Akteure und Interessen hinter der Entwicklung von KI-Technologien im Hintergrund und die Auswirkungen von KI-Nutzung bleiben zu häufig unbeleuchtet – Deep Fakes, algorithmische Biases, Auswirkungen von verzerrter Deliberation auf die Demokratie. In dieser Session wollen typische Muster bei der Berichterstattung über KI aufzeigen, alternative Ansätze vorstellen, diskutieren warum viele relevante KI-Themen es nicht bis zur Veröffentlichung schaffen – und Ideen für alternative „Drehs“ suchen.
16.00 – 17.00 Pause
16.15 – 17.00 Meet the Experts an den Ständen des WissensCampus (Programm-Übersicht als PDF)
17.00 – 18.30
A5_Diskussion
Die öffentliche Wahrnehmung von Forschenden mit Agenda
Prof. Bruno Burger (Fraunhofer ISE)
Friederike Hendriks (TU Braunschweig)
Niels G. Mede (Zurüch)
Marlene Weiß (SZ)
Volker Stollorz [Moderation]
Saal WISSEN
Montag 17.00 – 18.30 Saal WISSEN
A5_Diskussion
Die öffentliche Wahrnehmung von Forschenden mit Agenda

Prof. Dr. Bruno Burger
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE)

Dr. Friederike Hendriks
Leiterin fourC, TU Braunschweig

Dr. Niels G. Mede
Senior Researcher, Institut für Kommunikationswissenschaft, Universität Zürich

Dr. Marlene Weiß
Ressortleiterin Wissen, Süddeutsche Zeitung

Volker Stollorz [Mod.]
Geschäftsführer, Science Media Center (SMC)
Der Kassenschlager „Oppenheimer“ erinnert daran, wie stark Forschende sich in der Nachkriegsgeschichte politisch positioniert haben. Doch wie politisch dürfen Wissenschaftler:innen heute aus Sicht der Öffentlichkeit und von Journalist:innen sein? Manchmal sind „Sentinel Scientists“ mit epistemic proximity die einzigen, die zentrale politische Fragen auf der Basis noch unsicherer wissenschaftlicher Erkenntnisse einschätzen können. Spätestens seit Corona haben alle verstanden, wie schwierig die Grenzziehung zwischen dem bloßen Darstellen von Evidenz und dem Einfordern konkreter politischer Maßnahmen ist. Manche Forschende nutzten ihre Eminenz, um evidenten Unsinn zu verbreiten. In dieser Session diskutieren wir, wie Forschende mit einer klaren Themenagenda auf Journalist:innen und das Publikum wirken. Viele Forschende scheuen das nichtwissenschaftliche Terrain, andere mischen sich lautstark ein, solidarisieren sich zum Beispiel mit Aktivist:innen von „Fridays for Future“. Schadet das ihrem Ruf als Wissenschaftler:innen? Wann dürfen sich Forschende klar positionieren, also policy advice liefern? Was macht vertrauenswürdige Forschende aus Sicht des Publikums aus? Wie sollten Journalist:innen mit Themenanwält:innen umgehen? Bei welchen Themen birgt aktivistisches Auftreten von Forschenden Risiken für das öffentliche Vertrauen in Wissenschaft?
A6_Deep Dive
Brain‐Computer‐Interfaces: Maschinen, die Gedanken lesen
In Kooperation mit dem VMWJ
Prof. Tonio Ball (Neuromedical AI Lab),
Svenja Wiertz (IEGM),
Joachim von Zitzewitz (Onward Medical),
Thomas Bleich [Moderation]
Saal DATEN
Montag 17.00 – 18.30 Saal DATEN
A6_Deep Dive [KI]
Brain‐Computer‐Interfaces: Maschinen, die Gedanken lesen
In Kooperation mit dem VMWJ

Prof. Dr. Tonio Ball
Leiter, Neuromedical AI Lab, Universitätsklinikum Freiburg

Svenja Wiertz
Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, Universität Freiburg

Dr. Joachim von Zitzewitz
Director Systems Engineering, Onward Medical

Dr. Thomas Bleich [Mod.]
Dr. Thomas Bleich, Arzt und Medizinjournalist, ZDF / Vorstand VMWJ
Durch Brain-Computer-Interfaces (BCI) können über Gedanken z.B. Computer, Smartphones oder Prothesen sprach- und bewegungsunabhängig gesteuert werden. Damit eröffnen sich für Menschen mit Querschnittslähmung, Schlaganfällen oder Locked-In Syndrom neue, dringend benötigte und vielversprechende Therapieoptionen, um sich wieder bewegen oder kommunizieren zu können. In diesem Jahr sorgten neue BCI für Aufsehen: Im Mai berichtete ein Forschungsteam aus Lausanne, dass ein querschnittsgelähmter Patient mit einem Brain-Spine-Interface (BSI) sein Gefühl in Armen und Beinen zurückerlangt habe. Im August erschienen zwei Nature-Studien zu neuentwickelten Hirn-Computer-Schnittstellen, die eine noch nie dagewesene Fähigkeit zur Übersetzung von Gehirnsignalen in Sätze bieten – mit einer Geschwindigkeit, die der normalen Sprache nahe kommt, und mit einem Wortschatz von mehr als 1.000 Wörtern. Doch welche Anwendungsbereiche sind langfristig realistisch? Wie weit entfernt sind wir von einem tatsächlichen Nutzen von BCIs für die Patienten, und auf welchem Stand ist die aktuelle Forschung? Und welche ethischen Probleme ergeben sich aus einer Anwendung von BCIs jenseits medizinischer Anwendungsbereiche?
A7_Diskussion
Andere Länder, andere Corona‐Sitten – die internationale Berichterstattung
In Kooperation mit der WPK
Anja Martini (ARD aktuell),
Astrid Viciano (Dt./Spanien),
Christine Westerhaus (Schweden),
Katrin Zöfel (Schweiz),
Claudia Ruby [Moderation]
Saal MEDIEN
Montag 17.00 – 18.30 Saal MEDIEN
A7_Diskussion
Andere Länder, andere Corona‐Sitten – die internationale Berichterstattung

Anja Martini
Leiterin Ressort Wissen, ARD-aktuell / tagesschau

Dr. med. Astrid Viciano
Leiterin Medien-Doktor GESUNDHEIT, TU Dortmund

Christine Westerhaus
Freie Wissenschaftsjournalistin (Göteborg)

Katrin Zöfel
Wissenschaftsredakteurin, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)

Claudia Ruby [Mod.]
Biologin und Wissenschaftsjournalistin / Vorstand WPK
Anfang 2020 breitete sich das Coronavirus mit rasender Geschwindigkeit weltweit aus. Kein Land blieb verschont – doch der Umgang mit der Pandemie war weltweit höchst unterschiedlich. Während sich Australien und Neuseeland weitgehend von der Welt abschotteten, ergriff China wohl die härtesten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Auch in Europa wurde intensiv über den richtigen Umgang mit der Pandemie gestritten: Wir wollen uns vier Länder genauer ansehen: Deutschland, die Schweiz, Spanien und Schweden.
Im Mittelpunkt der Session steht – natürlich – der Wissenschaftsjournalismus und die Berichterstattung über die Pandemie. Welche Rolle spielte „die“ Wissenschaft in den Medien? Worüber wurde gestritten, und wie gut kamen die Länder durch die Pandemie? Welche kulturellen Unterschiede wurden deutlich? Diesen Fragen gehen die Journalistinnen in diesem Panel nach – und bringen dabei auch ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Perspektiven ein.
Inklusive Preisverleihung “European Science Journalist of the Year” der European Federation for Science Journalism (EFSJ) (ca. 18:15 Uhr)
ab 18.30 ABENDPROGRAMM in der Markthalle Freiburg „20 Jahre WISSENSWERTE“
#Carl Zeiss Stiftung #Journalistenpreis PUNKT (inkl. Catering)
Donnerstag, 26.10.2023
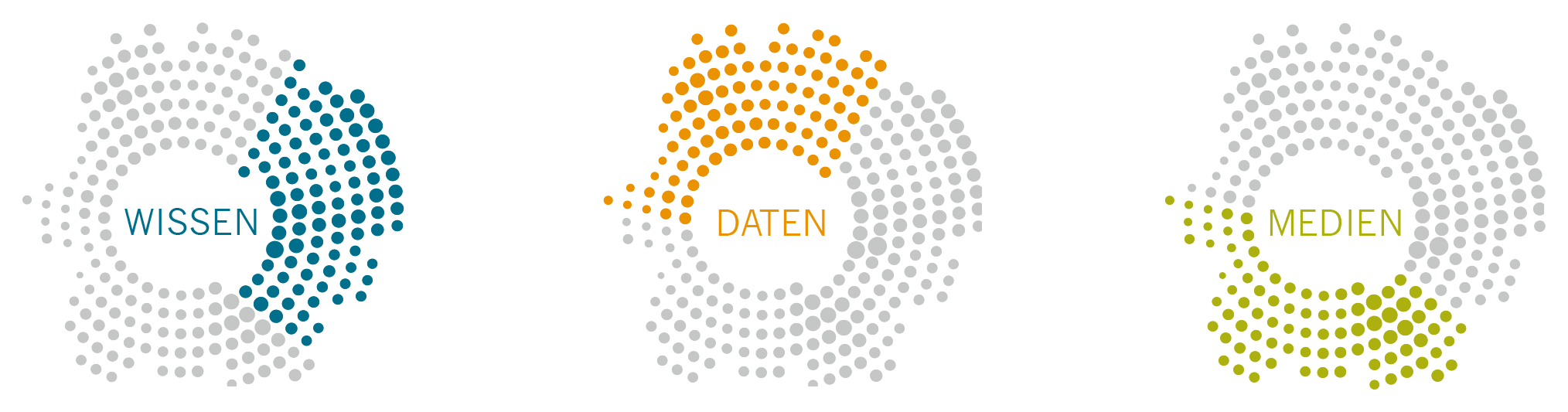
9.00 – 10.00 B1_Diskussion
Interessenkonflikte im Journalismus: Wie wir mit den eigenen COI umgehen
Pia Heinemann (FAZ), Dagny Lüdemann (ZEIT online), Caroline Ring (Freischreiber), Niklas Schurig (MEZIS), Cornelia Stolze (Freie Journalistin), Martina Lenzen-Schulte [Moderation]
Saal WISSEN
Donnerstag, 26.Oktober 9.00 – 10.00 Saal WISSEN
B1_Diskussion
Interessenkonflikte im Journalismus: Wie wir mit den eigenen COI umgehen

Dr. Pia Heinemann
Redakteurin Natur & Wissenschaft, FAZ

Dagny Lüdemann
Chefreporterin Wissen, ZEIT ONLINE

Caroline Ring
Freie Autorin / Vorstand Freischreiber

Dr. Niklas Schurig
Vorstand, Mein Essen zahl' ich selbst (MEZIS)

Dipl.-Biol. Cornelia Stolze
Wissenschaftsjournalistin

Dr. Martina Lenzen-Schulte [Mod.]
Medizinjournalistin und Ärztin
Der Umgang mit Interessenkonflikten hat in Wissenschaft und Medizin immer mehr Bedeutung gewonnen: In jedem Journal ist es mittlerweile üblich, die COI (conflict of interest) der Autoren einer medizinischen Studie zu nennen. Auf Kongressen und Symposien müssen Speaker vor jedem Vortrag eine Folie mit ihren COI einblenden. Im Wissenschafts- und Medizinjournalismus dagegen ist die Angabe von eigenen COI nicht üblich – was zur Konsequenz hat, dass die Leser nicht erkennen können, ob der Artikel von einer gesponserten Pressereise stammt oder ob ein finanzieller „Zusammenhang“ zu Produkten oder Firmen besteht. Zudem können Journalist:innen, die ihre Reisen selbst bezahlen, nicht darstellen, dass sie und/oder ihre Redaktion sich ihre Unabhängigkeit etwas kosten lassen. Hinzu kommt, dass Redaktionen aus Geldnot solche Einladungen zunehmend attraktiver finden. Das Risiko liegt jedoch bei den Journalisten, die den „geldwerten Vorteil“ angenommen haben, ihn versteuern müssen und so auf der Payroll eines Unternehmens stehen. Muss der Journalismus also ebenso wie Wissenschaft & Medizin Transparenz herstellen? In dieser Session wollen wir diskutieren, ob Journalist:innen ihre Interessenkonflikte angeben müssen und wie COI benannt werden könnten. Wie ließe sich eine Offenlegung der COI praktikabel umsetzen? Und wie könnte ein positives Label aussehen und sich bezahlt machen?
10.00 – 10.45 Pause
10.00 – 10.45 Meet the Experts an den Ständen des WissensCampus (Programm-Übersicht als PDF)
10.45 – 12.15
B2_Deep Dive
Blackbox STIKO
Annegret Burkert (SMC),
Judith Koch (STIKO-Geschäftsstelle),
Prof. Jörg Meerpohl (STIKO),
Korinna Hennig [Moderation]
Saal WISSEN
Donnerstag, 26.Oktober 10.45 – 12.15 Saal WISSEN
B2_Deep Dive
Blackbox STIKO

Dr. Annegret Burkert
Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften, Science Media Center (SMC)

Dr. Judith Koch
STIKO-Geschäftsstelle, Robert Koch-Institut

Prof. Dr. Jörg Meerpohl
STIKO / Cochrane Deutschland / Universitätsklinikum Freiburg

Korinna Hennig [Mod.]
Wissenschaftsredakeurin, NDR Info
Public-Health-Themen werden den Wissenschaftsjournalismus weiter beschäftigen. Ein zentraler Player ist die Ständige Impfkommission (STIKO), die Impfempfehlungen für Deutschland entwickelt und dabei nicht nur deren Nutzen für das geimpfte Individuum, sondern auch für die gesamte Bevölkerung berücksichtigt. Während der Pandemie stand die STIKO angesichts der Infektionsdynamik kommunikativ stark unter Druck, in der Politik wird gerade offenbar diskutiert, wie das Gremium reformiert werden kann. Wie arbeitet die STIKO? Wie wird sie besetzt? Was sind die Perspektiven für eine Reform? Wie könnte die STIKO sich in der Kommunikation breiter aufstellen? Und was müssen wir Journalist:innen wissen, wenn wir ihre Empfehlungen der STIKO kommunizieren, analysieren oder kritisieren?
B3_WorkshopKI
KI im journalistischen Alltag – ändert sich was durch Bard oder ChatGPT?
Peter Welchering
Saal DATEN
Donnerstag, 26. Oktober 10.45 – 12.15 Saal DATEN
B3_Workshop
KI im journalistischen Alltag – ändert sich was durch Bard oder ChatGPT?

Peter Welchering
Wissenschaftsjournalist, Trainer & Dozent
Die Aufregung war groß. Als der Chatbot ChatGPT im November vergangenen Jahrtes in aller Öffentlichkeit die ersten eloquenten Antworten auf Fragen aller Art auswarf, der quadratisch blinkende Cursor wie von Zauberhand herzzerreißende Gedichte und ganze Referate hinter sich ließ, schienen die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz erstmals so richtig im Bewusstsein der Menschen angekommen zu sein. Seitdem geht es Schlag auf Schlag. Google hat mit Bard nachgezogen. Der erste Radiosender mit KI-Moderatoren nahm seinen Betrieb auf. Einige Medienhäuser setzen KI-Werkzeuge bereits in unterschiedlichen Bereiche ein. Insbesondere bei der Recherche, in der Text- und Bildproduktion, in der Verifikation und Faktenprüfung, bei der Themenfindung und –analyse sowie in der Distribution und bei der Analyse von Nutzer-Feedback. Welche Werkzeuge das sind, wie sie funktionieren und wo ihre Grenzen, aber auch Risiken in der Anwendung liegen, darum geht es in diesem Workshop. Ebenso schauen wir uns an, welche KI-Werkzeuge auf welchen Plattformen angeboten werden, was ihr Einsatz kostet und was Journalisten und Journalistinnen selbst an Tools verfertigen können.
B4_Workshop
Science Podcasts: Wie wird ein Podcast schön und erfolgreich?
Marie Eickhoff (Behind Science),
Ralf Krauter (KI verstehen),
Sebastian Kromer (Jung und Freudlos),
Gábor Paál (SWR2 Wissen),
Stefan Schmitt (Auch das noch?)
Karl Urban [Moderation]
Saal MEDIEN
Donnerstag, 26. Oktober 10.45 – 12.15 Saal MEDIEN
B4_Workshop
Science Podcasts: Wie wird ein Podcast schön und erfolgreich?

Marie Eickhoff
Wissenschaftsjournalistin & Podcasterin (Behind Science)

Ralf Krauter
Redaktion Forschung Aktuell, Deutschlandfunk (KI verstehen)

Dr. Sebastian Kromer
Facharzt für Psychiatrie & Podcaster (Jung und Freudlos)

Gábor Paál
Leiter Wissenschaft und Bildung, SWR (SWR2 Wissen)

Stefan Schmitt
Wissenschaftskorrespondent, DIE ZEIT (Auch das noch?)

Karl Urban [Mod.]
Freier Hörfunkjournalist und Podcaster, Tübingen
In diesem Hands-on-Workshop soll es darum gehen, wie man einen Podcast konzipiert und macht – und wie beides zusammenspielt: Braucht es zum Start das perfekte Konzept und die exakte Definition der Zielgruppe – oder ist es wichtiger einfach anzufangen, nach dem Silicon-Valley-Mantra fail fast, early and forward? Wie findet eine Idee ihr passendes Format? Und wie überwindet eine „schnelle Idee“ Widerstände in trägen Rundfunkanstalten? Weiterhin will Moderator Karl Urban mit seinen Gästen über Positionierung und Community Building sprechen: Wie wichtig ist für Podcasts eine eigene Community? Wie spreche ich Hörende an, wie geht das speziell bei sensiblen Themen? Warum ist ein „glasklares Profil“ des Podcasts extrem wichtig – und wie schafft man eine solche klare Profilierung? Außerdem auf der Agenda: Ansprache – wie Hosts mit den Hörer:innen reden & Storytelling – was die Zutaten für eine gute Geschichte sind.
MITMACH‐WORKSHOP
Animal City: Wie sich Tiere und Menschen in der Stadt bewegen
Carina Frey & Katharina Jakob (RiffReporter)
Saal OPEN FORUM
Donnerstag 10.45 – 12.15 Saal OPEN FORUM
Mitmach-Workshop
Animal City: Wie sich Tiere und Menschen in der Stadt bewegen
Carina Frey [Mod.]
Freie Wissenschafts- und Verbraucherjournalistin / RiffReporter
Katharina Jakob [Mod.]
Freie Wissenschaftsjournalistin / RiffReporter
Die Lebensräume für Wildtiere auf dem „freien“ Land brechen ein, Tiere drängen in den urbanen Raum. Wir müssen uns dieser Tatsache stellen und unseren städtischen Lebensraum mehr als früher mit anderen Spezies teilen. Aber wie geht das unfallfrei und zum Wohle aller?
Schutzzonen für Igel, Pop-up-Kunst für Insekten, Laichgewässer in Neubaugebieten, Wettbewerbe für Vogelschutz: In diesem Szenario-Building-Workshop entwickeln die Teilnehmenden Ideen und Lösungsansätze für eine grünere Stadt, in der sich Mensch und Tier den Lebensraum teilen und sichere Migrationsrouten und Lebensräume für Tiere eingeplant werden.
12.15 – 14.00 Pause & Buffet [WPK-Mitgliederversammlung]
14.00 – 15.30
B5_Diskussion
Evidenz im Keller? Die Debatte über das Heizungsgesetz
– und was wir wirklich wissen müssen
Karl-Heinz Büschemann (SZ),
Sabrina Fritz (SWR Wirtschaft),
Daniel Lingenhöhl (Spektrum),
Marek Miara (Fraunhofer ISE),
Prof Holger Wormer [Moderation]
Saal WISSEN
Donnerstag, 26. Oktober 14.00 – 15.30 Saal WISSEN
B5_Diskussion
Evidenz im Keller? Die Debatte über das Heizungsgesetz
– und was wir wirklich wissen müssen

Karl-Heinz Büschemann
Süddeutsche Zeitung

Sabrina Fritz
Leiterin Aktuelle Wirtschaftsredaktion, SWR

Dr. Daniel Lingenhöhl
Chefredakteur, Spektrum der Wissenschaft

Marekt Miara
Business Developer Heat Pumps, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE)

Prof Holger Wormer [Mod.]
Lehrstuhl Wissenschaftsjournalismus, TU Dortmund
„Habecks Heiz-Hammer“, „Mega-Strafen für Wärmepumpen-Muffel“, „Heizungsverbot“,der SPIEGEL-Titel mit dem Robert und der Rohrzange im Keller – die Berichterstattung über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) war extrem emotional und polarisierend. Kaum ein klimapolitisches Thema wurde so kontrovers diskutiert wie die Pläne zum Heizungsgesetz. Wir wollen darüber nachdenken, wie es passieren konnte, dass so viele Falschannahmen und Falschbehauptungen in der Öffentlichkeit herumgeistern und Faktentreue und Evidenz so rasch in den Keller rauschen konnten. Sind die Medien auf eine Kampagne hereingefallen? Welche guten Beispiele der Berichterstattung gab es? Und wie lassen sich solche Themen an der Schnittstelle von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft in den Redaktionen generell besser bearbeiten? Darüber hinaus wollen wir die „Gebäudeenergiegesetzevidenz“ (GEGE) ;-) steigern – und die Fakten zu Heizungsgesetz, Wärmewende und Wärmeplanung herausarbeiten, die wir Journalist:innen für die kommenden Monate kennen sollten.
B6_Deep Dive
Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen
Prof. Melanie Börries (Uniklinik Freiburg),
Prof. Philipp Kellmeyer (Universität Mannheim),
Prof. Saskia Nagel (RWTH Aachen),
Dr. Patrick Rockenschaub (F-IKS),
Bastian Zimmermann [Moderation]
Saal DATEN
Donnerstag, 26. Oktober, 14.00 – 15.30 Saal DATEN
B6_Deep Dive [KI]
Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen

Prof. Dr. Dr. Melanie Börries
Direktorin, Institut für Medizinische Bioinformatik und Systemmedizin,
Universitätsklinikum Freiburg

Jun.-Prof. Dr. med. Philipp Kellmeyer
Juniorprofessor für Responsible AI & Digital Health, Universität Mannheim / Leiter Human-Technology Interaction Lab, Universitätsklinikum Freiburg

Prof. Dr. Saskia Nagel
Professorin für Angewandte Ethik, RWTH Aachen

Dr. Patrick Rockenschaub
Senior Researcher, Trustworthy AI, Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme (IKS)

Bastian Zimmermann [Mod.]
Redakteur Digitales & Technologie, Science Media Center (SMC)
Die Digitalisierung und komplexe Algorithmen sind zentrale Bausteine in der Medizin der Zukunft. Doch wer stellt sicher, dass die Ergebnisse sicher und zuverlässig sind? Wie bleiben Diagnosen nachvollziehbar? Wer verantwortet am Ende die falsche Diagnose? Und wie sorgen die Hersteller dafür, dass die KI niemanden diskriminiert?
B7_Workshop
Wie sollten wir über assistierten Suizid berichten – und wie nicht?
Manuel Bogner (ZEIT Online),
Prof. Thomas Niederkrotenthaler (Wien),
Nina Poelchau (Freie Journalistin),
Claudia Ruby (Freie TV-Journalistin),
Martina Keller [Moderation]
Saal MEDIEN
Donnerstag, 26. Oktober 14.00 – 15.30 Saal MEDIEN
B7_Workshop
Wie sollten wir über assistierten Suizid berichten – und wie nicht?

Manuel Bogner
Redakteur Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, ZEIT ONLINE

Prof. Thomas Niederkrotenthaler
Associate Professor & Leiter Suizidforschung, Medizinische Universität Wien

Nina Poelchau
Freie Journalistin

Claudia Ruby
Biologin und Wissenschaftsjournalistin / Vorstand WPK

Martina Keller [Mod.]
Freie Medizinjournalistin
Derzeit ist ein neues Phänomen zu beobachten: Die Medien berichten ausführlich, detailliert, prominent und nicht selten romantisierend über den assistierten Suizid. Hintergrund ist die neue Rechtslage nach dem Urteil des BVG, nach der jeder Mensch einen verfassungsrechtlich geschützten Anspruch auf Hilfe bei der Selbsttötung hat. Die meisten Berichte verstoßen jedoch gegen Regeln wie den Pressekodex (Ziffer 8.7) und Leitlinien, die detailliert beschreiben, was riskant ist und vermieden werden sollte. Wie kann eine angemessene Berichterstattung über assistierten Suizid aussehen? Was sagen Forscher zur Wirkung der Berichte? Was sind aus Sicht der Suizidprävention No-Gos?
15.30 – 16.00 Pause
16.00 – 17.30
B8_Deep Dive
Weiße Biotechnologie: Mit Mikroorganismen zu mehr Nachhaltigkeit?
Tim Börner (HES-SO Valais-Wallis),
Michael Köpke (LanzaTech) [tbc],
Christine Rösch (KIT),
Doreen Schachtschabel (BASF),
Sigrid März [Moderation]
Saal WISSEN
Donnerstag, 26. Oktober 16.00 – 17.30 Uhr Saal WISSEN
B8_DeepDive
Weiße Biotechnologie: Mit Mikro-organismen zu mehr Nachhaltigkeit?

Dr.-Ing. Tim Börner
Senior Researcher, HES-SO Valais/Wallis

Dr. Michael Köpke
Chief Innovation Officer, LanzaTech

Dr. Christine Rösch
Leiterin Nachhaltige Bioökonomie, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)

Doreen Schachtschabel
Vice President R&D White Biotechnology, BASF

Dr. Sigrid März [Mod.]
Freie Wissenschaftsjournalistin / MedWatch / RiffReporter
Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit könnte die Weiße Biotechnologie bald eine Schlüsselrolle spielen. Weltweit erforschen Molekularbiologen die Fähigkeit jener Mikroben, Hefen und Pilze, die aus natürlichen Ressourcen Produkte herstellen. Dabei optimieren Wissenschaftler:innen die Mikroorganismen im Labor so weit, dass sie in der Lage sind, Haushalts- und Industrieabfälle, aber auch CO2 aus der Luft zu neuen Produkten umzuwandeln. Per Fermentation oder Biokatalyse lässt sich das im großindustriellen Maßstab umsetzen.
Wegen ihrer ökonomischen und ökologischen Chancen ist diese Technik für Grundlagenforscher und Anlagentechniker zunehmend attraktiv. Besonders im Fokus stehen kohlenstofffixierende Mikroben – sie können zum Beispiel CO2 aus Industrieabgasen in Biokraftstoffe umwandeln –, aber auch Mikroben, die Enzyme produzieren, mit denen sich Kunststoff nachhaltiger abbauen lässt, als bisherige Recyclingverfahren das leisten. Wir wollen erfahren, welches Potenzial in der Weißen Biotechnologie steckt, wenn es um Bioabbaubarkeit, Kreislaufwirtschaft und Nutzung alternativer Rohstoffquellen geht – und inwieweit die Weiße Biotechnologie Teil einer Transformation sein kann, in der fossile Rohstoffe ersetzt werden.
B9_Screening
Neue Wege – der Innovationsfonds Wissenschaftsjournalismus
Christian Basl (DataSonifyer),
Markus Hörmann (SourceJournal),
Katja Richter (CO2mitted Media),
Astrid Viciano (Medien-Doktor Assistance),
Alexandra Hostert [Moderation]
Saal DATEN
Donnerstag 16.00 – 17.30 Saal DATEN
B9__Screening
Neue Wege – der Innovationsfonds Wissenschaftsjournalismus

Christian Basl
DataSonifyer

Dr. Markus Hörmann
SourceJournal

Katja Richter
CO2mitted Media

Dr. med. Astrid Viciano
Leiterin Medien-Doktor GESUNDHEIT, TU Dortmund

Alexandra Hostert [Mod.]
Biologin & Journalistin / Vorstand WPK
Der WPK-Innovationfonds unterstützt Pionier:innen, die im Wissenschafts- und Datenjournalismus neue Wege beschreiten wollen. Wir stellen neue Projekte vor, die vom Innovationsfonds gefördert werden:
- DataSonifyer will Daten und ihre Dynamiken in Klänge übersetzen, um Wetter-, Finanz-, Social Media- oder Klima-Daten hörbar zu machen – was bislang für Radio und Podcast nicht möglich ist.
- SourceJournal zielt auf die Entwicklung einer Data-Management-Software, die typische Aufgaben des Datenjournalismus vereinfacht und automatisiert, sodass man auch ohne eigene Programmierkenntnisse Daten aus verschiedenen Quellen abspeichern, visualisieren und als Dashboard, Diagramme oder Tabellen einbetten kann.
- Journalismus mit Klimaverantwortung: CO2mmitted Media entwickelt einen offenen CO2-Rechner für den Journalismus, der mit wenigen Parametern angibt, wie viele Klimagase die Produktion eines journalistischen Beitrags verursacht hat.
- Medien-Doktor ASSISTANCE will die Wissenschafts- und Medizinberichterstattung in Regionalmedien mit einem neuen Tool zur Qualitätssicherung stärken. Ziel ist die Entwicklung eines Assistenzsystems für Redaktionen – mit datenjournalistischen bis hin zu Machine-Learning-Methoden
In dieser Session stellen vier Teams ihre Idee (und das Problem, dass sie lösen wollen), ihren Ansatz und die Herausforderungen vor und stellen sich den Fragen des Publikums. https://innovationsfonds.wpk.org/
B10_Werkstattgespräch
Research.Table
Nicola Kuhrt & Tim Gabel (Table.Media)
Saal MEDIEN
Donnerstag, 26. Oktober 16.00 – 17.30 Saal MEDIEN
B10_Werkstattgespräch
Research.Table

Nicola Kuhrt
Redaktionsleiterin Research.Table / Vorstand WPK

Tim Gabel
Redakteur Research.Table
Newsletter und Briefings sind zu einem wichtigen Instrument der Informationsbeschaffung und Meinungsbildung für Entscheider geworden – und mischen den Journalismus auf. In dieser Session wollen wir uns eines der spannendsten journalistischen Innovationsprojekte hierzulande ansehen: „Table.Media – For better informed decisions.“ Das digitale Verlagshaus in Berlin hat sich auf Fachnewsletter (Professional Briefings) spezialisiert und will „Deep Journalism“ bieten, indem es den Qualitätsanspruch von Leitmedien mit der Tiefenschärfe von Fachinformationen verbindet. In diesem Werkstattgespräch steht der „Research.Table“ im Mittelpunkt, der über Wissenschaftspolitik, Forschungsstrategien, Innovationsmanagement und Research Funding berichtet. Redaktionsleiterin Nicola Kuhrt und Redakteur Tim Gabel stellen uns ihren redaktionellen Ansatz und die Strategie bei der Neugründung vor: Wie hat das Team die Idee strategisch entwickelt, wo will es sich im journalistischen Markt positionieren? Wie wichtig sind Marketing und Community Building für das Projekt? Und: Was hat die Redaktion in der Startphase gelernt?
17.45 – 18.30 B11_Begnungen
Die Migrationsdebatte in den Medien – warum dringen die Fakten nicht durch?
Saal WISSEN
Donnerstag, 26. Oktober 17.45 – 18.30 Saal WISSEN
Die Migrationsdebatte in den Medien – warum dringen die Fakten nicht durch?

Daniel Bax
Redakteur im Parlamentsbüro, taz

Prof. Dr. Frank Kalter
Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM)

Christina Sartori
Freie Hörfunkjournalistin, Berlin
„Schaffen wir das noch mal?“, titelt der SPIEGEL mit einer endlos erscheinenden Karawane flüchtender Menschen. Gleichzeitig scheinen sich die Parteien in den politischen Talkshows mit schärferer Migrationspolitik überbieten zu wollen. Viele Medien greifen dabei auf das emotionale Bild der „Flut“ zurück und suggerieren, dass wir überflutet werden von viel zu vielen Menschen, die hier Schutz vor Krieg und Hunger suchen. Die Fakten sehen anders aus: In den letzten Jahren gab es nur marginal mehr Asylanträge als in den Jahren zuvor – nicht mal die Hälfte der Zahl von 2015 und 2016. Befeuern Redaktionen mit ihrer Berichterstattung aktuell eine Angstdebatte? Was kennzeichnet die mediale Migrationsdebatte? In dieser Session wollen wir aus journalistischer und migrationswissenschaftlicher Perspektive herausarbeiten, was an der medialen Debatte über Migration falsch läuft, welche Aspekte in den kommenden Monaten wirklich wichtig werden – und wo Journalist:innen dazu Evidenz & Expertise finden.
Freitag, 27.10.2023
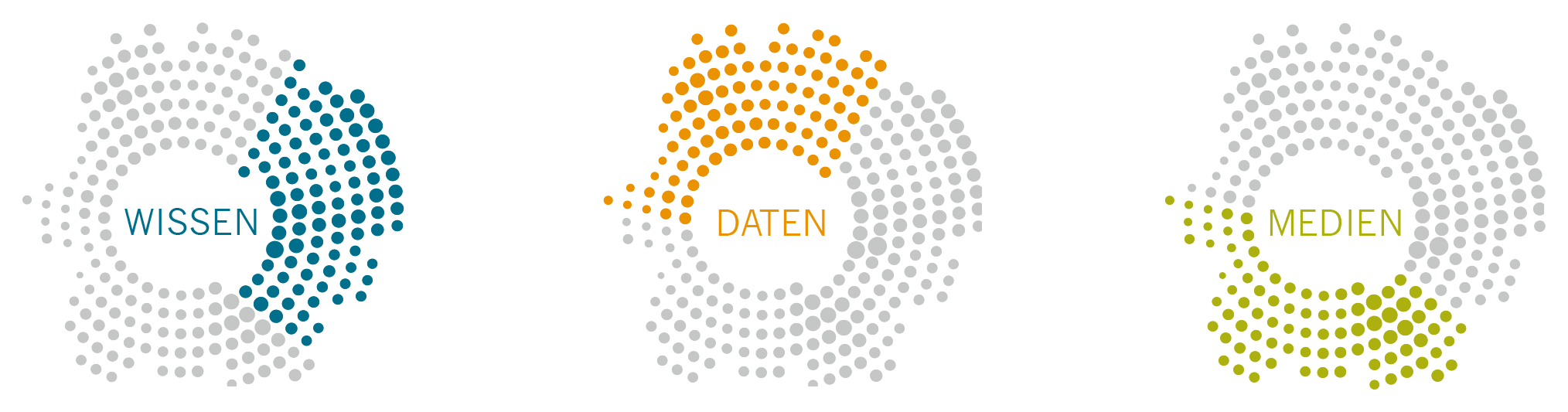
Meet the Experts
Nutzen Sie die einmalige PR-Plattform. Die Forschung und Ihre Ergebnisse brauchen persönliche Kontakte, um in die Massenmedien zu gelangen.
Meet the Experts: Ein Dialog-Campus
Treffen Sie am Mittwoch, 25. Okt., 16.15 – 17.00 Uhr und Donnerstag, 26. Okt., 10.00 – 10.45 Uhr, Experten zu bestimmten Themen an ausgewählten Ständen, die als Gesprächspartner bereitstehen. Die Themen, Experten und Zeiten finden Sie hier als PDF-Download
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne!
Holger Hettwer M.A.
Programmplanung
+49 (0)160 7095051
holger.hettwer@tu-dortmund.de

